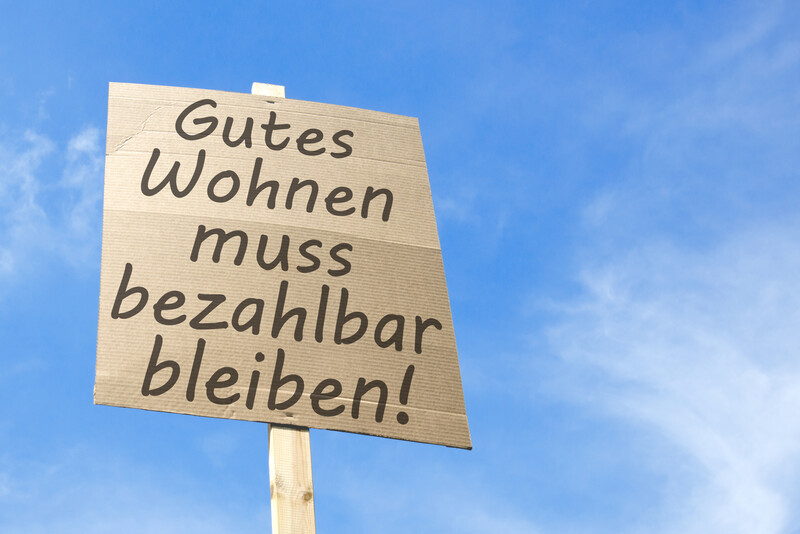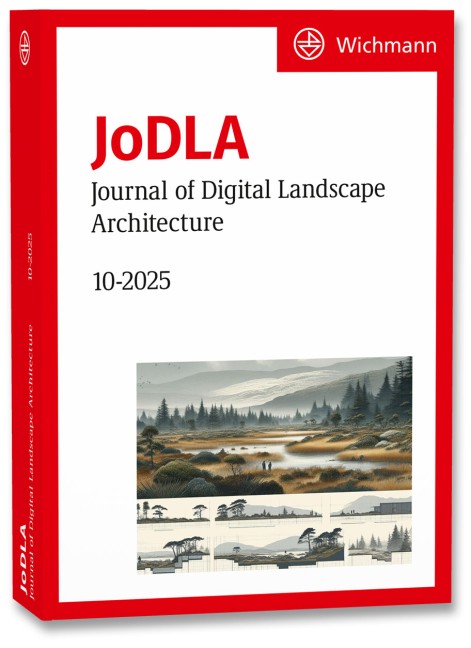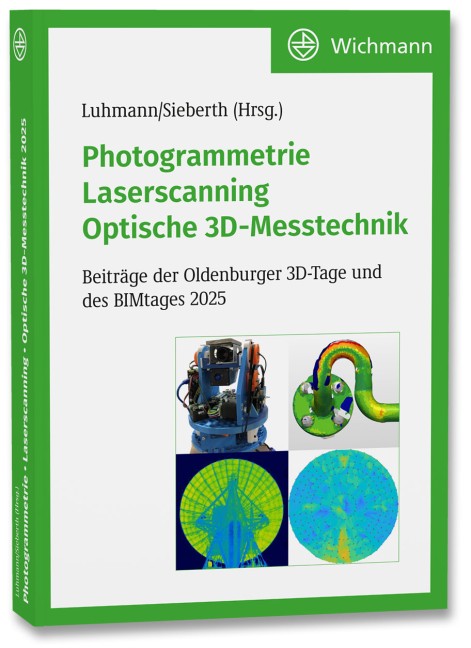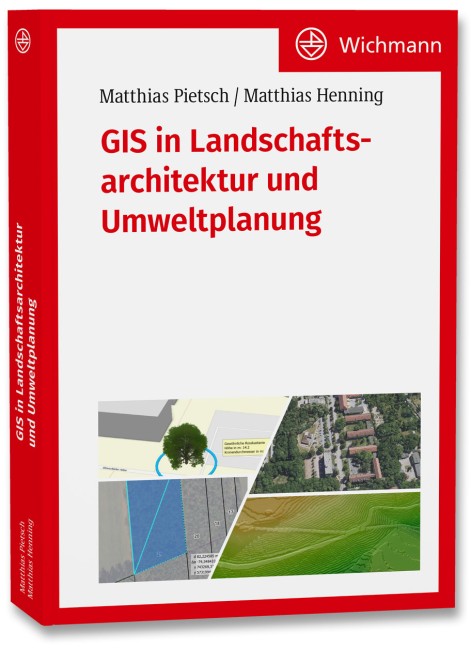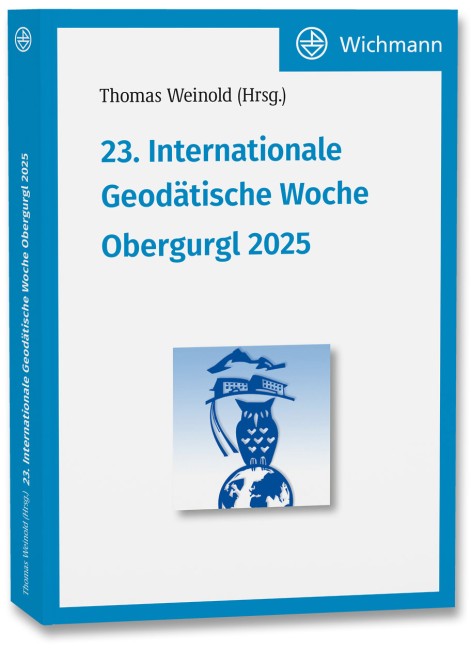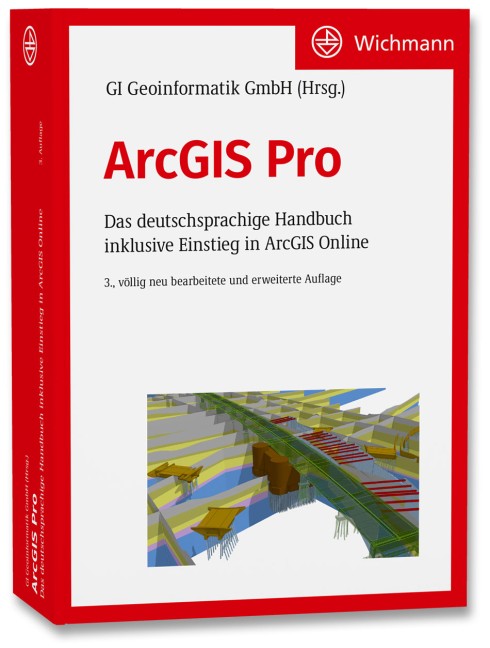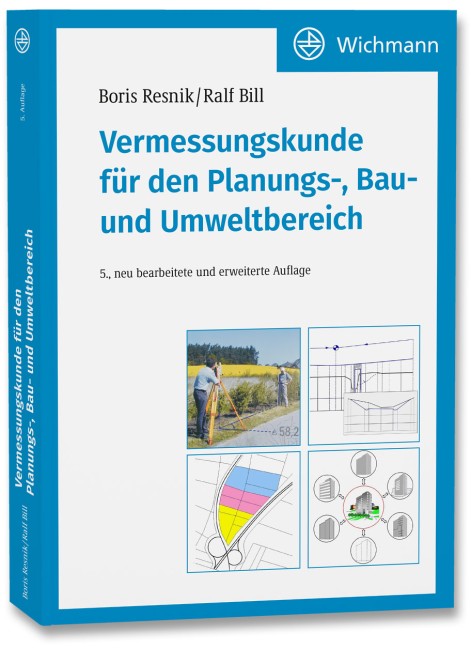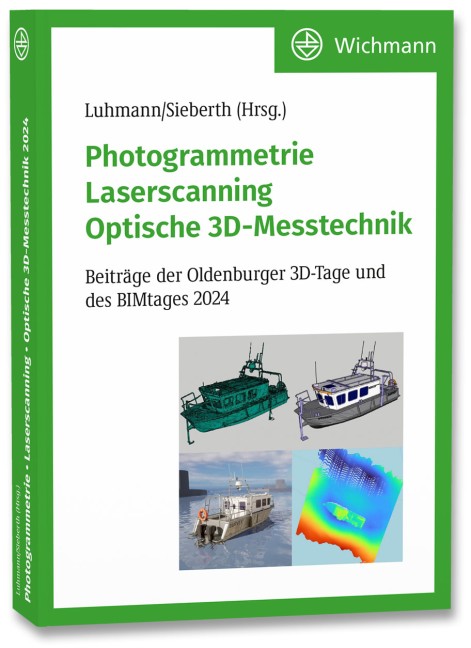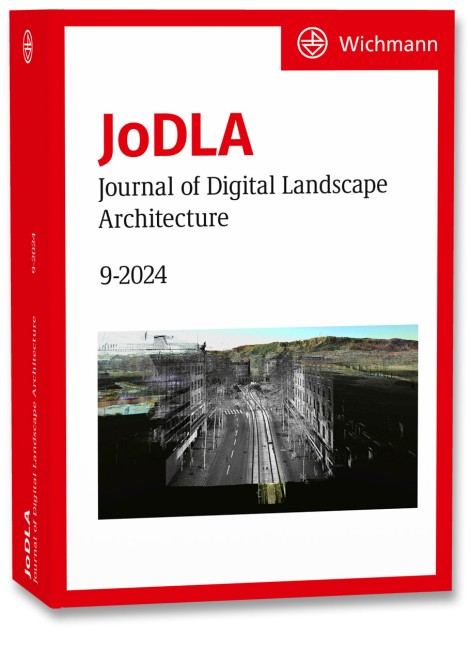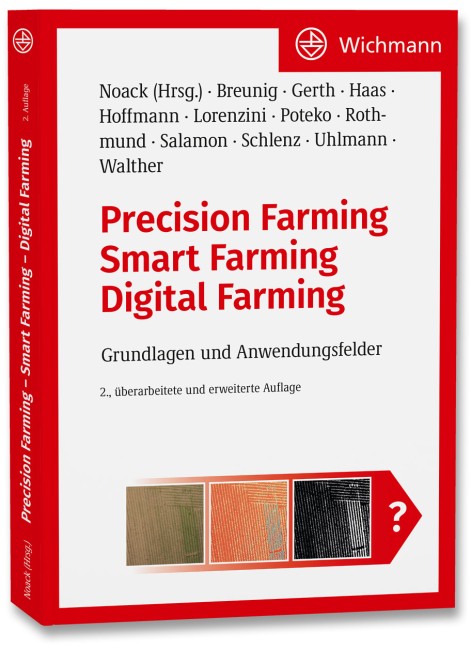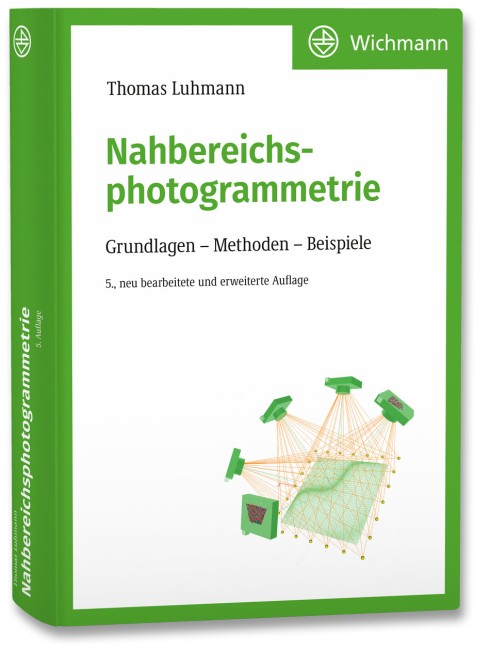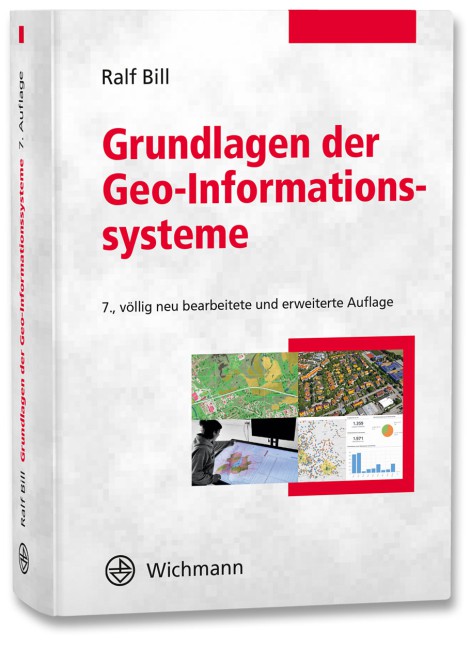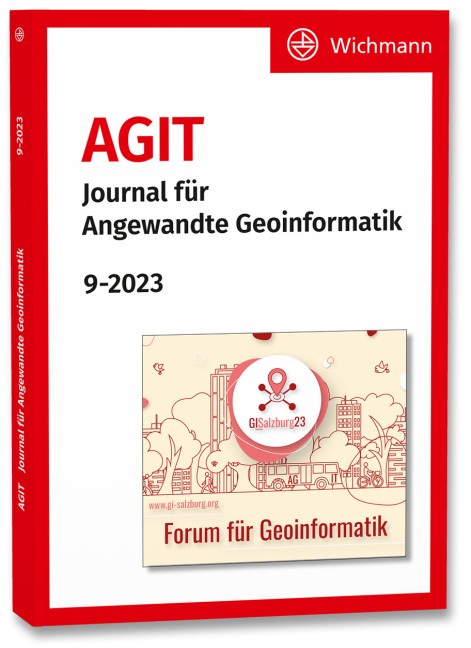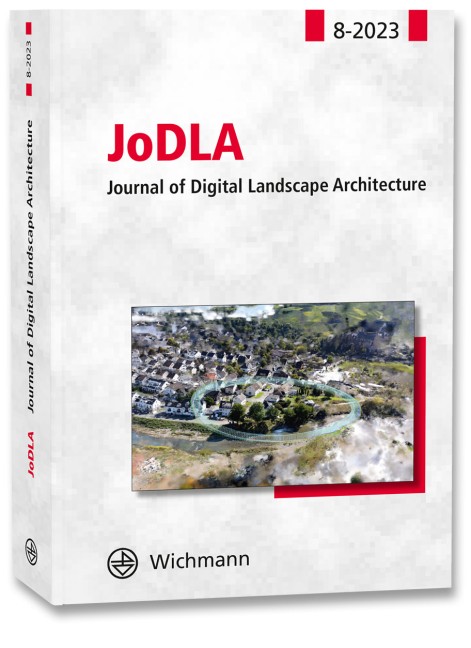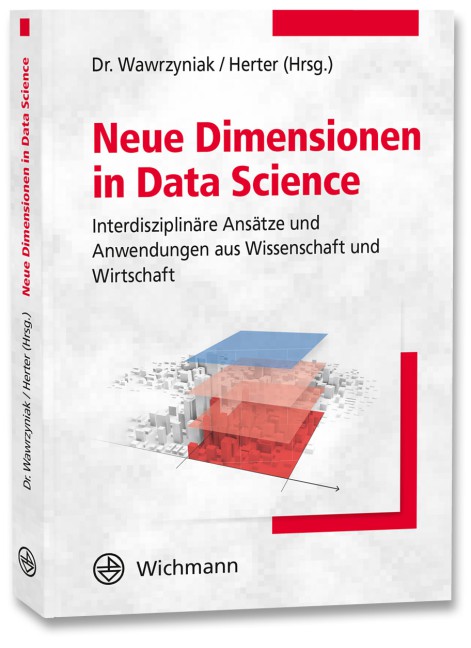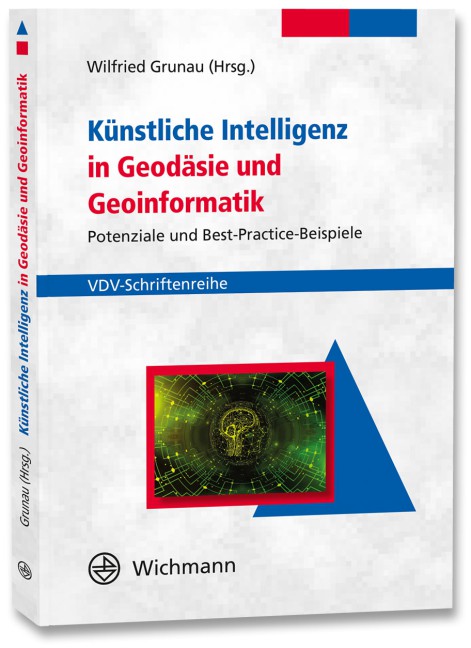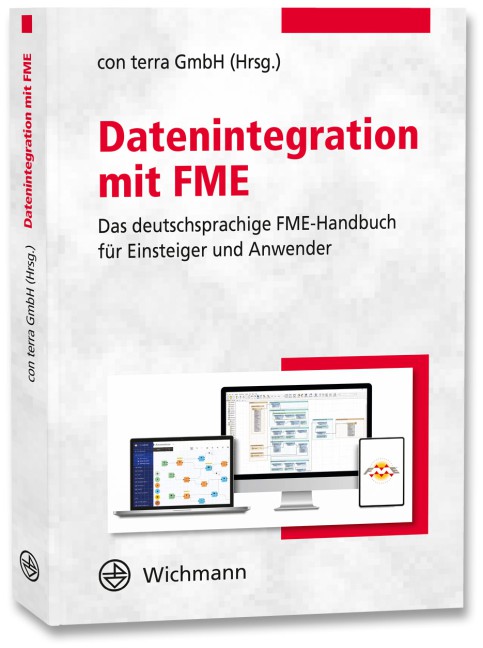Aktuell zeigt das Deutsche Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt am Main eine Ausstellung zu den „Herausforderungen neuer Quartiere in Deutschland“. Der Titel: „Stadt Bauen Heute?“ Die Veranstalter schreiben hierzu: „Die Entwicklung innovativer Stadtquartiere ist heute eine Herausforderung für viele deutsche Städte. Aspekte wie Klimaschutz, Mobilität, soziale Integration und demografischer Wandel müssen berücksichtigt werden.“ Grundsätzlich ist laut DAM-Verantwortlichen „eine Stadt (…) niemals eine abgeschlossene Planung. Strukturen zu schaffen, die flexibel und offen sind, um Veränderungen aufzunehmen, gehört ebenfalls zu den ganz großen Herausforderungen einer zukunftsfähigen Quartiersplanung heute.“ Wie passend liest sich in diesem Zusammenhang der etwas holprige Ausstellungstitel. Im übertragenen Sinne kommen wir damit von den „ganz großen Herausforderungen“ der Sprache zu den nicht weniger Großen beim Bauen und Wohnen hierzulande.
Politische Platzhalter
Eine zentrale Herausforderung lautet: mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Denn in Deutschland ist dieser knapp. Das zu ändern war und ist für die Politik eine wahre Herkulesaufgabe. Ein Umstand, an dem auch die Verantwortlichen des unter dem ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) neu gegründete Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, kurz BMWSB, Ende 2021 bis dato wenig ändern konnten. Aktuell steht dem Bauministerium Verena Hubertz von der SPD vor. Wie ihre Vorgängerin im Amt, Klara Geywitz, ebenfalls SPD, verbreitet V. Hubertz viele Platzhalter. Zu lesen ist von „Rekordmitteln für den sozialen Wohnungsbau“, vom „mehr bauen“ und „günstiger bauen“ sowie dem Bauen von „Perspektiven und nicht nur Wohnungen“. Das fügt sich nahtlos in K. Geywitz Sprechblasen an, wonach sozialer Wohnungsbau so heiße, „weil er bezahlbar ist. Nicht, weil er schlechter ist“. Oder: „Wir brauchen Innovationen in der Bauwirtschaft und deshalb fördern wir innovatives Bauen, um zu einem besseren Bauen zu kommen. Besser heißt: bezahlbar, ressourcenschonend, klimafreundlich und nicht zuletzt schneller (…)“. Dass Politiker die Dinge gern schön reden, gehört zu deren Geschäft. Mit Blick auf den Bausektor ist diese Schönfärberei allerdings seit Jahrzehnten an der Tagesordnung.
Erfahren Sie mehr zum Thema Bauen und Wohnen in der aktuellen Ausgabe 4/2025 der gis.Business, unter anderem im Rahmen des Titelbeitrags „Wohnungsbau: Wünsch dir was ist keine Lösung“ (Bezahlschranke).
Das Potenzial von BIM und KI sowie den notwendigen Fähigkeiten
In diesem Konglomerat aus politischen Phrasen, einer ausufernden Bürokratie und der Flut an Vorschriften soll es vielfach die Geo-IT richten. So werden seit Jahren beispielsweise das Building Information Modeling, kurz BIM, oder der Einsatz der künstlichen Intelligenz (KI) in der Bauwirtschaft sowie von wissenschaftlicher Seite hervorgehoben. Allerdings läuft der Einsatz digitaler Methoden und Lösungen in der Baubranche hierzulande eher schleppend. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens PwC zum „Umgang der Baubranche mit den aktuellen Herausforderungen“ vom Februar 2024 zeigt sich eine eher „zurückhaltende Entwicklung der Potenziale und Fähigkeiten in den Bereichen Digitalisierung“ bei den Bauunternehmen. So zeigen die Ergebnisse unter anderem: Im Bereich der Simulation und Visualisierung sehen 74 Prozent der Befragten ein sehr und eher großes Potenzial. Aber nur 34 Prozent besitzen nach eigenen Aussagen sehr starke oder eher starke Fähigkeiten in diesem Umfeld. Ähnlich verhält es sich im BIM-Bereich, dem 62 Prozent großes Potenzial zusprechen, doch nur 23 Prozent die notwendigen Fähigkeiten mitbringen. Noch düsterer sieht es im KI-Umfeld aus, mit 45 Prozent Zuspruch bei den Potenzialen, aber nur sechs Prozent der Befragten die notwendigen Fähigkeiten vorweisen.
Ähnlich düstere Zahlen zeigen sich bei den Planern und denen, die Projekte steuern. Anzumerken bleibt an dieser Stelle, dass es sich bei der PwC-Studie rein um Ergebnisse aus Interviews mit Entscheidern von Bauunternehmen sowie Planungsfirmen und Ingenieurdienstleistern handelt. Nun liegt jede Befragung im Sinne des Auftraggebers und es werden positivere Zahlen zur Digitalisierung des Baugewerbes geben. Festzuhalten bleibt indes, dass wir in Deutschland massiven Nachholbedarf bei digitalen Strukturen haben – gerade in Verwaltungen. Darüber können auch Vorzeigestädte wie Hamburg, Stuttgart oder München nicht hinwegtäuschen. Randnotiz: Selbst in den großen Metropolen hierzulande hilft die vielfach gelobte Digitalisierung bisher wenig, um den Wohnungsbau voranzutreiben. Zu teuer, zu unattraktiv, zu bürokratisch und am Ende zu vage in der Gewinnmaximierung für private Bauherrn. Da lässt man als Privatinvestor lieber die Finger von Bauvorhaben hierzulande. Oder beantwortet die Eingangsfrage des Titels der DAM-Ausstellung zu „Stadt Bauen Heute?“ mit einem klaren nein.